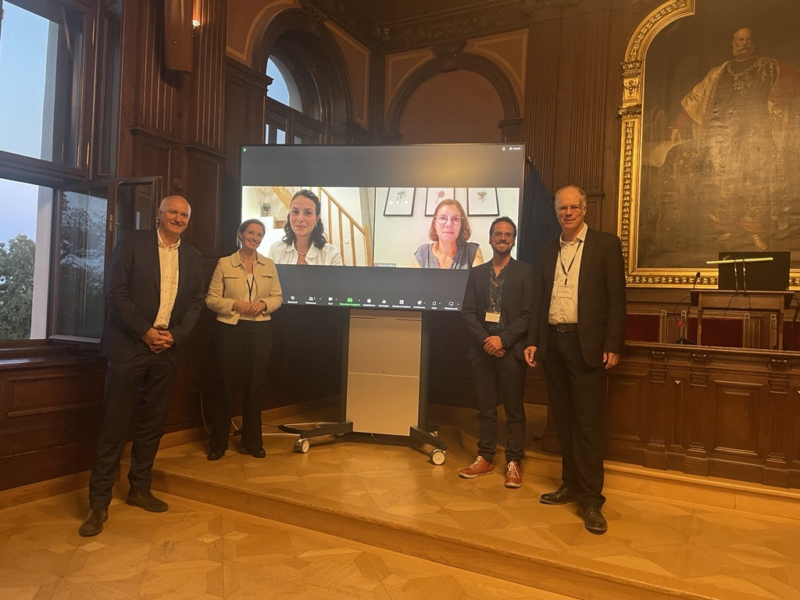"Fair-Heat": Optionen für eine sozial gerechte Wärmewende
Um die Klimaziele zu erreichen, ist ein rascher und umfassender Ausstieg aus fossilen Energieträgern erforderlich. Während der Anteil fossiler Energieträger im österreichischen Gebäudesektor in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken ist, stellt eine vollständige Dekarbonisierung des Sektors bis 2040 eine Herausforderung dar und erfordert erhebliche Investitionen.
Der Gebäudebestand muss umfassend thermisch saniert werden und die Heizsysteme müssen vollständig auf erneuerbare Energieträger umgestellt werden. Darüber hinaus gilt es, den Anstieg des Kühlbedarfs aufgrund des unvermeidbaren Klimawandels zu berücksichtigen. Die Verbreitung von Wärmepumpen wird sich daher wahrscheinlich fortsetzen. Dies setzt auch den Elektrizitätssektor unter Druck, wo die geplante Umstellung auf erneuerbare Energieträger mit der steigenden Stromnachfrage Schritt halten muss.
Die Transformation des Wohngebäudesektors wird für verschiedene Haushaltsgruppen unterschiedliche Auswirkungen haben, die von mehreren Aspekten abhängen, wie der thermischen Qualität der Wohnung, dem verwendeten Heizsystem, der Verfügbarkeit von Fernwärmenetzen sowie dem Einkommen, dem finanziellen Hintergrund und institutionellen Aspekten der Haushalte (z. B. Miet- oder Eigentumswohnung), die die Finanzier- und Durchführbarkeit von Dekarbonisierungsmaßnahmen bestimmen.
Das Ziel von "Fair-Heat" ist es, einen Beitrag zur Forschung über die Verteilungsaspekte der Energiewende zu leisten. Konkret liegt der Fokus auf den folgenden vier Forschungsfragen:
- Durch welche Maßnahmenkombinationen kann eine Dekarbonisierung von Wohngebäuden bis 2040 erreicht werden, unter expliziter Berücksichtigung von Fernwärme und -kälte und der Interaktionen mit dem Stromsektor?
- Wie hoch ist der Investitionsbedarf für die Dekarbonisierung von Wohngebäuden? Welche Investitionen sind im Gebäudesektor und welche in der Energieinfrastruktur erforderlich?
- In welchem Ausmaß sind Maßnahmen erforderlich, um schutzbedürftige Haushalte bei der Wärmewende zu unterstützen und die Belastung durch hohe Investitionskosten für gebäudeseitige Maßnahmen und potenziell höhere Kosten für Fernwärme abzumildern?
- Was sind geeignete Mechanismen, um die Kosten der Dekarbonisierung zwischen den verschiedenen Akteuren (d. h. dem öffentlichen Sektor, den Energieversorgern und den Haushalten) aufzuteilen?
Zur Beantwortung dieser vier Forschungsfragen werden Modellsimulationen von Dekarbonisierungsoptionen für österreichische Wohngebäude bis 2040 durchgeführt, wobei Fernwärme und -kälte sowie die Wechselwirkungen mit dem Stromsektor explizit Berücksichtigung finden. Zusätzlich werden aktuelle Erkenntnisse und Daten zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Nachfrage nach Wärme und Kälte in die Analyse einbezogen. Dazu werden das makroökonomische Modell DYNK, das Gebäudebestandsmodell Invert/EE-Lab und das Energiesystemmodell IESopt erweitert und miteinander gekoppelt. Neben der technischen und ökonomischen Modellierung liegt der Fokus auf der sozialen Dimension der Wärmewende. Ergänzt um eine Literaturrecherche und einen breiten Stakeholder-Dialog dienen die Modellsimulationen und die umfassende Analyse der sozialen Aspekte als Grundlage für die Entwicklung von Politikempfehlungen für eine faire Wärmewende in Österreich.
Das Projekt "Fair-Heat" wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programmes ACRP durchgeführt.
Rückfragen an